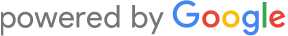Im Kanton Zürich wird derzeit über die Wohnschutz-Initiative diskutiert. Ziel ist es, den bestehenden Mietwohnungsbestand zu sichern und die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern durch Umwandlungen, Sanierungen oder Abrisse einzudämmen. Die Initiative sieht neue Instrumente für Gemeinden vor, um bei einem angespannten Wohnungsmarkt regulierend einzugreifen.
Hintergrund: Was steckt hinter der Wohnschutz-Initiative?
Im Jahr 2026 entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Zürich über mehrere Vorlagen rund um den Wohnungsmarkt. Eine davon ist die kantonale Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen schützen. Leerkündigungen stoppen (Wohnschutz-Initiative)», die darauf abzielt, den Anstieg der Mieten stärker unter staatliche Kontrolle zu bringen.
Kernanliegen der Initiative ist es, den Gemeinden mehr Handlungsspielraum zu geben: Sie sollen künftig Bewilligungspflichten für Abbrüche, Umbauten, Sanierungen oder Nutzungsänderungen einführen können. Ebenso wäre es möglich, die Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum zu begrenzen. Diese Bewilligungen dürften zudem an Auflagen zur Mietzinsgestaltung gekoppelt werden. Getragen wird die Initiative vom Zürcher Mieterverband sowie von SP, Grünen und AL.
Voraussetzung für die Anwendung solcher Schutzmassnahmen ist laut Initiativtext ein ausgewiesener Wohnungsmangel in der jeweiligen Gemeinde – konkret dann, wenn die Leerwohnungsziffer unter 1.5 % liegt. Gemäss der jüngsten Erhebung vom 1. Juni 2025 trifft dies auf 147 von 160 Zürcher Gemeinden zu. Sollte die Initiative im kommenden Jahr angenommen werden, ist anzunehmen, dass insbesondere Gemeinden mit starkem Rückhalt für SP, Grüne und AL von diesen neuen Kompetenzen Gebrauch machen. Ein Blick auf die Ergebnisse der Kantonsratswahlen 2023 lässt bereits erkennen, wo entsprechende Umsetzungen wahrscheinlich sind.
Kernpunkt: Beschränkung der Umwandlung in Stockwerkeigentum
Besonders brisant ist der Punkt "Beschränkungen für die Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum". Was verbirgt sich dahinter?
- Bewilligungspflicht: Gemeinden können vorschreiben, dass jede geplante Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bewilligt werden muss.
- Mietzinsauflagen: Solche Bewilligungen können mit Auflagen zur Mietzinsbegrenzung verbunden sein. Diese werden im Grundbuch angemerkt und gelten verbindlich für die Eigentümer:innen.
- Sistierung von Verfahren: Solange die Bewilligung nicht erteilt ist, wird die Grundbuchanmeldung blockiert. Das sorgt für Verzögerungen und Planungsunsicherheit.
- Rechtsmittel: Mieter:innen und Verbände können Rekurs einlegen. Dadurch verlängern sich Verfahren und Investitionsentscheidungen zusätzlich.
- Sanktionen: Wer Auflagen missachtet, riskiert empfindliche Bussen – unter Umständen in unbegrenzter Höhe.
Kurzum: Falls die Initiative angenommen wird, wird die Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum deutlich komplizierter, zeitintensiver und risikobehafteter.
Auswirkungen auf Eigentümer:innen
Viele Hauseigentümer:innen fragen sich nun, wie sie auf diese möglichen Veränderungen reagieren sollen. Besonders relevant ist die Initiative für Eigentümer:innen, die schon länger planen, ihre Liegenschaften in Stockwerkeigentum (STWEG) aufzuteilen. Die Sorge: Bei einer späteren Umsetzung könnten Behörden nicht nur die Bewilligung verzögern, sondern auch Einschränkungen und Mietzinsbindungen auferlegen. Das könnte sowohl die Rendite als auch die Flexibilität im Umgang mit den Wohnungen stark beeinträchtigen.
Warum jetzt handeln? Weil die politische Entwicklung unsicher ist, entscheiden sich derzeit viele Eigentümer:innen, noch vor einer möglichen Annahme der Initiative tätig zu werden. Wer die Umwandlung rechtzeitig einleitet, verschafft sich Planungssicherheit und vermeidet mögliche Auflagen oder Verzögerungen in der Zukunft.
Archify unterstützt Eigentümer:innen in genau diesem Schritt
Damit eine Umwandlung ins Grundbuch eingetragen werden kann, braucht es aktuelle und präzise STWEG-Pläne (Stockwerkeigentumspläne). Diese Pläne sind die Grundlage für die rechtlich saubere Aufteilung einer Liegenschaft in Miteigentumsanteile.
- Erstellung neuer STWEG-Pläne nach den aktuellen Vorgaben.
- Aktualisierung bestehender Pläne, falls die Unterlagen veraltet oder nicht normkonform sind.
- Präzise CAD-Umsetzungen durch erfahrene Architekt:innen und Ingenieur:innen.
- Effiziente Abwicklung, damit Eigentümer:innen rechtzeitig handeln können.
Die Wohnschutz-Initiative im Kanton Zürich könnte den Spielraum für Umwandlungen in Stockwerkeigentum erheblich einschränken. Wer rechtzeitig aktiv wird, kann noch von der aktuellen Rechtslage profitieren und sich unnötige Hürden ersparen. Archify ist Ihr Partner, wenn es darum geht, STWEG-Pläne professionell zu erstellen oder zu aktualisieren und somit die Grundlagen für eine rechtssichere Eigentumsumwandlung zu schaffen.
Jetzt handeln: Deshalb lohnen sich STWEG-Pläne durch Archify
- Entlastung vom regulatorischen Risiko: Durch frühzeitige Einreichung einer Umwandlung in Stockwerkeigentum sichern sich Eigentümer:innen gegenüber potenziellen Mietzinsauflagen, Verzögerungen oder anderen Beschränkungen ab – noch bevor neue Beschlüsse greifen.
- Planungssicherheit schaffen: STWEG-Pläne sind die Grundlagen für die rechtliche und administrative Trennung von Eigentumsanteilen. Archify sorgt mit geübter CAD- und Planexpertise dafür, dass diese Unterlagen vollständig, normkonform und bereit für die Grundbuchanmeldung sind.
- Marktposition stärken: Während andere Eigentümer:innen möglicherweise abstimmen oder reagieren, ist mit präzisen STWEG-Plänen bereits ein ernsthaftes Umwandlungsziel dokumentiert – das verschafft Zeitvorteile und Klarheit.
Risiken laut Wüest Partner
Die Analyse nennt klare Konsequenzen für Immobilienportfolios:
- Value at Risk (VaR) steigt: Potenziell sinkende Renditen durch Mietzinsbegrenzung und eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten.
- Risikomanagement wird notwendig: Portfoliobewertungen müssen angepasst werden, um neue Werte und Strategien zu berücksichtigen.
Ferner hat Wüest Partner untersucht, dass Massnahmen wie Mietzinsdeckel kurzfristig zwar Mieten dämpfen können, langfristig jedoch Investitionsbereitschaft und Instandhaltung sinken – was wiederum die Wohnqualität beeinträchtigt und Neubauten antreiben kann.
Erfahrungen aus Basel-Stadt als Referenz
Die Rechtslage in Basel-Stadt, die als Vorlage für Zürich dienen könnte, zeigt:
- Sanierungen kaum noch rentabel: Vermieter:innen sehen wegen begrenzter Mietanpassung kaum Anreiz zur Instandhaltung.
- Sanierungsstau droht: Langfristig könnte der Gebäudebestand verfallen und dringend nötige energetische Sanierungen ausbleiben.
Konsequenzen für Eigentümer:innen im Kanton Zürich
- Gebietsabhängige Unsicherheit: Da Gemeinden autonom entscheiden, ob und wie sie Massnahmen einführen, herrscht grosse Rechtsunsicherheit.
- Investitionsdruck steigt: Bei drohenden Auflagen oder Verzögerungen durch Bewilligungsprozesse steigt der Handlungsdruck.
- Wert und Nutzung im Fokus: Eigentümer:innen müssen prüfen, wie sich solche Eingriffe auf die spätere Nutzung und Wertentwicklung auswirken.
Weiterführende Informationen zur Wohnschutzintiative im Kanton Zürich finden Sie unter www.wohnraum-schuetzen.ch.